Suche
Filme
Filmlisten
Leider wurden keine Ergebnisse zu Ihrem Suchbegriff gefunden
Filme
Unterhaltung
Kunst & Kultur
Dokumentarfilme
Gesellschaft
Klassiker
Familie
Filmkunst
Regionen
Director's Choice
Abos und Preise
Geschenk-Abo
Hilfe / FAQ
Kontakt
Politik & Geschichte
Engagiertes Kino ist immer auch explizit politisches Kino. Hier haben wir ein paar Filme ausgesucht, die Politik und/oder Geschichte ins Zentrum rücken.
Do it (2000)
Sabine Gisiger und Marcel Zwingli
Schweiz
97′
Sechzehn Jahre alt ist der Zürcher Daniele von Arb, als er 1970 mit zwei Freunden eine revolutionäre Zelle gründet und in den bewaffneten Untergrund zieht – die Gruppe taucht ein paar Jahre später in den Akten der CIA unter dem Codenamen «Annebäbi» auf. Daniele
und seine Genossen versuchten, mit spektakulären Aktionen für ihre Anliegen zu kämpfen. So räumten sie Schweizer Armeedepots aus und belieferten die italienischen Brigate Rosse und die deutsche RAF mit Sprengstoff. Erst 1975 flog die Gruppe auf. Zwanzig Jahre später ist Daniele von Arb nach mehrjähriger Haftstrafe ein erwachsener Mann, der als Wahrsager und Zukunftsforscher arbeitet.
Mit einer guten Mischung aus Ironie und Ernsthaftigkeit rollen Sabine Gisiger («Yalom's Cure») und Marcel Zwingli den Fall auf und werfen einen kritischen Blick auf linken Extremismus, ohne dessen Anliegen abzuwerten. Mit exklusivem Archivmaterial und Zeitzeugeninterviews bietet «Do It» eine humorvolle und spannende Rückschau auf ein Stück Zürcher Geschichte.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Desobediência – Disobedience (2002)
Licínio Azevedo
Mosambik
92′
Rosa hat kein leichtes Leben. Ihr Mann hilft ihr kaum bei der Feldarbeit und wenn er betrunken ist, schikaniert er sie. Als er sich erhängt, bekommt Rosa keinerlei Unterstützung von seiner Familie, im Gegenteil. Sie wird beschuldigt, einen Pakt mit einem Geist eingegangen zu sein und ihren Mann in den Tod getrieben zu haben. Unterstützt von ihrer Mutter macht sie sich auf die Suche nach einem traditionellen Heiler, der bereit ist, sich um den schwierigen Fall zu kümmern. Die Mitwirkenden im Film sind die beteiligten Personen eines realen Konflikts. Weil sie ständig zwischen Darstellung und wirklichem Konflikt hin- und hergerissen sind, entschied sich Licinio Azevedo, dokumentarische Sequenzen in den Film zu integrieren.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Kosh ba Kosh (1990)
Bachtiar Chudonasarow
Tadschikistan
92′
Mira, eine junge Frau aus Russland, kommt nach Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, um ihren Vater zu besuchen, einen Spieler, der oft verliert und schliesslich sogar Mira an einen alten Mann verspielt. Doch Daler, ein junger Mitspieler, verliebt sich in Mira und entführt sie ganz einfach in seine ziemlich schräge Welt. Daler ist nämlich Chef der örtlichen, durch und durch vergammelten Luftseilbahn. Seine verblichenen gelben Kabinen taugen für jede Fracht: Touristinnen und Touristen genauso wie für Heu, Bierkisten, Diebesgut und sogar als Liebeslaube für luftige Schäferstündchen.
Für Mira arrangiert Daler ein romantisches Picknick, schwebend zwischen Himmel und Erde. Und so beginnt auch schon die Liebesgeschichte von Mira und Daler. Wenn der Film endet (nicht aber die Liebe), wird Mira eine fremde, manchmal auch exotische Welt kennengelernt haben. Sie wird einen Bürgerkrieg gesehen haben. Sie wird ihren Vater in den Tod begleitet haben und Daler auf dem Weg in ein neues Leben.
Walter Ruggle
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Opera Jawa (2006)
Garin Nugroho
Indonesien
115′
Ein Seh- und Hörerlebnis der besonderen Art, ein Gesamtkunstwerk mit Sprengkraft. Der indonesische Regisseur Garin Nugroho, der für die Vielfalt seiner erzählerischen Stile und die mutige Bewältigung umstrittener Themen bekannt ist, hat mit «Opera Jawa» seinen vielleicht klarsichtigsten Film geschaffen. Er feiert darin traditionelle Formen von Gamelan-Musik, Tanz und Performances und verbindet diese mit zeitgenössischen Gesangs- und Tanzstilen sowie mit Drehorten, die moderne Installationskünstler transformiert haben. Dabei hat er eine neue Form des Musicals ins Leben gerufen, eine «Oper für das 21. Jahrhundert».
Er adaptiert eine der berühmtesten Geschichten des «Ramayana», des grossen Klassikers der indischen und südostasiatischen Literatur. Es ist die Geschichte eines leidenschaftlichen Liebesdreiecks: Die schöne Siti und ihr Ehemann betreiben eine Töpferei, aber die Dinge laufen nicht so, wie sie sollten, und als ihr Mann Setio fort ist, versucht der mächtige und skrupellose Händler Ludiro sie zu verführen. Siti verfängt sich in den Stricken eines Konflikts. Mit bewundernswerten Leistungen seiner drei Hauptdarstellenden und dazu den Kompositionen des berühmtesten Gamelan-Maestros Rahayu Supanggah, hat Nugroho einen Film geschaffen, dem es auf erstaunliche Weise gelingt, freudig multikulturellen Selbstausdruck zu feiern und zugleich ein Requiem über den Schmerz zu sein.
Die Religionsfrage ist auch in Indonesien brisant, einem muslimischen Staat mit starken fundamentalistischen Strömungen. Garin Nugroho ist selbst Muslim, aber in seinem alltäglichen Leben in Yogyakarta gibt es viele andere multikulturelle und religiöse Einflüsse. Die Bilder und Symbole, die in Yogyakarta verwendet werden, stammen oft aus dem Hinduismus, ist der Islam doch noch nicht allzu lange im Inselstaat zu Hause. Nugroho wehrt sich dagegen, dass die Regierung die Religion als politisches Mittel einsetzt.
Nugroho feiert die visuellen und akustischen Dimensionen des Kinos. Kino, das sind Bilder, das sind Bewegungen, ist die Erzählung. Drei Dimensionen, die er mit all ihren ästhetischen Mitteln ausschöpft. Farben und Lichter charakterisieren jede der Szenen, verleihen ihnen atmosphärische Dichte und dem Geschehen bei aller Härte Zärtlichkeit und Harmonie. Die Erzählung ist von Musik beseelt. Gefühle der Figuren oder Kommentare des Chors werden durch den Gesang zum Ausdruck gebracht und zeugen von den durchlebten Prüfungen. Durch den Tanz erst kommt die Sinnlichkeit zum Ausdruck, die Gefühlswelt und das Umherirren, das Zweifeln der Helden. Die Musik ist in Form des Gamelanorchesters nicht nur hörbar: sie ist auch sichtbar und damit Teil des visuellen Konzepts. Diese aus Glockenläuten, Perkussionen und Gongs zusammengesetzten musikalischen Formen stammen aus Jawa und aus Bali und sind bewusst und nachdrücklich ins Bild gesetzt.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Reise zur Sonne (1999)
Yesim Ustaoglu
Türkei
110′
In «Günese Yolculuk» (Reise zur Sonne) hat die türkische Regisseurin Yeșim Ustaoğlu in langwierigen Dreharbeiten mit militärischen Interventionen gleich mehrere Themen aufgegriffen, die in ihrer Heimat eigentlich tabu sind. Sie redet von Kurdistan, sie zeigt Aufnahmen von staatlicher Gewalt, und sie macht auf bewegende Art vor allem eines deutlich: Frieden ist dann möglich, wenn man sich wechselseitig ernst nimmt und akzeptiert. Um den anderen zu respektieren, müsste man sich bewusst werden, dass man an den meisten Orten dieser Welt ein Fremder, eine Fremde ist und man genauso gut in der Haut des anderen stecken könnte.
Zwei junge Männer aus entgegengesetzten Regionen der Türkei begegnen sich in diesem wunderbaren Film zufällig in Istanbul und werden Freunde. Beide hoffen auf eine bessere Zukunft und versuchen, in der Grossstadt ein Auskommen zu finden. Berzan stammt aus einem kurdischen Dorf im äussersten Osten und schiebt als fliegender Händler jeden Morgen seinen Karren mit Musikkassetten in die Stadt. Mehmet ist erst kürzlich aus der Westtürkei hier angekommen und findet einen Job bei den Wasserwerken, wo er mit einem archaisch anmutenden Hörrohr die Strassen nach geborstenen Leitungen abhorcht. Es ist, als würde er nach Strömungen suchen, die an der Oberfläche nicht wahrnehmbar sind, aber sehr wohl vorhanden und lebensspendend.
Mehmet hat es nie interessiert, dass Berzan Kurde ist. Was für ihn zählt, sind die Träume der beiden, die Freude am Zusammensein, die Nähe, die wohl tut. Wichtig ist ihm ihre Freundschaft, in der es kein Wenn und Aber gibt, in der das Zwischenmenschliche entscheidend ist und die Sehnsucht. Berzan sehnt sich nach seinem Heimatdorf zurück, wo er glaubt, dass seine Verlobte auf ihn warten würde, während Mehmet sich in Istanbul in die feinfühlige Arzu verliebt hat. Sie war in Deutschland aufgewachsen. Inzwischen ist Arzu in ihre alte Heimat zurückgekehrt und muss hier erleben, wie rasch einer in den Verdacht kommen kann, der politischen Opposition anzugehören. Die Regisseurin erzählt ihren hochgradig politischen Stoff auf packende Weise. Atmosphärisch dicht und stimmungsbewusst schildert sie Freundschaft und Liebe, feinfühlig charakterisiert sie ihre Figuren und eindrücklich gestaltet sie die Reise in den äussersten Osten ihrer Heimat, in bei uns kaum bekannte Regionen. Mit Geschick versteht Yeșim Ustaoğlu es dabei, politische Ereignisse in die erfundene Handlung einzuflechten und ein subtiles, vielschichtiges Drama von einer Sprengkraft zu gestalten, die an Herz wie Geist rührt.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Kick Off (2009)
Shawkat Amin Korki
Irak
81′
Das Fussballstadion in Kirkuk, dem kurdischen Norden Iraks, ist der Hauptschauplatz des neusten Spielfilms von Shawkat Amin Korki. Hier haben sich die verschiedensten Familien eingenistet, um darauf zu warten, dass sich ausserhalb des Stadions das Leben wieder normalisiert. Ihr improvisierter Alltag ist zur Normalität geworden. Ein zärtlicher Film über einen explosiven Zustand, eine Komödie, die die Tragödie erst richtig zeigt.
Jede Minute eine Kostbarkeit Der Irak, ein Filmland? Das würde man kaum sagen, denn man weiss: Das Land hat schwere Zeiten hinter sich und diese alles andere als überwunden. Umso erstaunlicher wirkt der kleine Film Kick Off aus dem nördlichen Kirkuk, der Hauptstadt der kurdischen Bevölkerung. Der Kurde Shawkat Amin Korki, der bereits mit seinem Erstling Crossing the Dust Aufsehen erregt hat, inszeniert in einem ausgedienten Fussballstadion ein Stück Gegenwart, in dem die Realität Komödie spielt und die Menschen auf eine Zukunft warten, die vielleicht einmal kommt und vielleicht auch nie. Die Gegenwart ist alles, was sie haben, jede Minute eine Preziose, denn schon die nächste kann die letzte sein. Das gilt ja eigentlich überall auf der Welt und für alles Leben, aber hier und in diesem Stadion, das zum Lebensraum einer bunten Menschengruppe geworden ist, ganz besonders intensiv und verrückt. Der Film Kick Off hatte seine Premiere im reichen südkoreanischen Pusan, einer Millionenstadt mit einem der wichtigsten Filmfestivals der Welt und Shopping-Malls als Veranstaltungsorten. Gerade in diesem konsumorientierten Umfeld packte die mit spärlichsten Mitteln äusserst subtil erzählte Geschichte, weil ihr Autor uns nichts vormacht. Korki hat sich für Schwarzweiss als Hauptfarbe entschieden und darin einzelne Tupfer eingebaut, die mit zum Charme seiner stillen Komödie gehören und zum Spiel, das er sich erlaubt. Es ist, als würde er uns bedeuten: Verliert nur zwei Dinge nie im Leben: Die Liebe und den Humor. Auch wenn alles zum Verzweifeln ist.
Walter Ruggle
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Ein Sechstel der Erde (1926)
Dziga Wertow
Russland
74′
Dziga Wertow, der das alte "Kino-Drama" als literarische Koketterie verwirft, hat erstmals das von allen anderen Künsten abgehobene Wesen des Films klar formuliert. Im Gegenzug zum Spielfilm, der die Kamera zwinge, das menschliche Auge zu kopieren, habe man zu berücksichtigen, dass das Kinoauge anders und exakter als das "unbewaffnete Auge" sehe. Wertows nachgerade mystischer Glaube an die Schöpfungsgewalt der Filmsprache duldet keinerlei Hindernisse, keine Mauern der Entfernung und Grenzen der Zeit. So verbindet Šestaja čast' mira Bilder der europäischen und asiatischen Teile der UdSSR zu einem "Gesang der Welt", der den Sozialismus mit dem Kapitalismus konfrontiert. Die aussergewöhnliche Magie seiner Filme beruht in Vertovs Fähigkeit, die beiden Ursprünge des Mediums - die wiedergegebene Realität und deren Neuerschaffung durch Montage - in höchster Spannung zu vereinen. (Filmmuseum Wien, H.T.)
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Ecuador
Jacques Sarasin
Ecuador
75′
Im Andenland Ecuador tut sich einiges, ohne dass es draussen in der Welt richtig wahrgenommen würde. Präsident Rafael Correa hat mit seinem Land eine der vorbildlichsten Verfassungen erarbeitet und vom Volk absegnen lassen. Jacques Sarasin schaut hin und lässt uns staunen: Ein Land, das zu sich selber steht. 2007 machte die Regierung unter Präsident Rafael Correa den waghalsigen Vorschlag, das gesamte Erdöl in diesem Nationalpark unter der Erde zu belassen (was 20% der Erdölreserven Ecuadors ausmacht) - unter der Bedingung, dass der ecuadorianische Staat die Hälfte der entgangenen Erträge von der internationalen Gemeinschaft zurückbekommt. Dieses Geld würde in einen Fonds zur nachhaltigen Entwicklung des Landes einfliessen und etwa der Verbreitung erneuerbarer Energien zugutekommen. Konkret würde diese Initiative bedeuten, dass der Welt über 400 Millionen Tonnen in die Atmosphäre ausgestossenes Kohlendioxyd erspart bleiben. Damit würde Ecuador zwar auf mehrere Milliarden Dollar verzichten, dafür aber der Zerstörung eines der vielfältigsten Gebiete der Welt entgegenwirken und damit eindeutig Pionierarbeit leisten. Das Erdöl stellt für den kleinen Andenstaat das wichtigste Exportgut dar - weit wichtiger noch als der hierzulande bekannte Kakao oder die Bananen -, hat dem Land aber auch schon viele Umwelt- und Gesundheitsprobleme sowie Konflikte mit der indigenen Bevölkerung des Regenwaldes beschert. Die ecuadorianische Regierung hängt völlig von den Erdöleinnahmen ab, und insofern ist die Yasuni-Initiative für ein so armes Land wie Ecuador ein ziemlich gewagtes, aber auch mutiges Unterfangen.
Rafael Correa ist Protagonist dieses Zeitdokumentes, und er tritt nicht zum ersten Mal in einem Film von Jacques Sarasin auf. Correas Politik wird uns aber auch von anderen Seiten dargelegt: Der gegenwärtige Aussenminister und ehemalige Wirtschaftsminister Ricardo Patiño, der ehemalige Energieminister Alberto Acosta sowie ein versierter Soziologe sind gewichtige Interviewpartner Sarasins. Gemeinsam ist den meisten von ihnen die Suche nach einer neuen Entwicklungsform für Länder wie Ecuador, die im Weltmarktgeschehen eine benachteiligte Position einnehmen. Viele von ihnen - ausgenommen der einzigen kritischen Stimme im Film vom Präsidenten der Privatbanken Ecuadors - plädieren für das etwas vage Konzept des «Sozialismus des 21. Jahrhunderts», ein Begriff, der vor allem durch Hugo Chávez in Venezuela bekannt wurde. Damit soll ein neues Gesellschaftsmodell ausgehandelt werden, in dem der Mensch und die Natur dem Kapital übergeordnet sind.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Ken Bugul
Silvia Voser
Senegal
64′
Ken Bugul ist eine Schriftstellerin, die dort lebt, wo ihre Seele zu Hause ist: in Afrika. Ihr Leben verläuft aussergewöhnlich. Der Film von Silvia Voser zeigt uns eine Biographie als Spiegel der Situation aller Frauen und als Reflexion der Beziehungen zwischen Afrika und dem Westen. Ken Bugul wird als eine der hervorragendsten senegalesischen SchriftstellerInnen der französischsprachigen Literatur der letzten Jahrzehnte betrachtet. Ihre Romane sind ein wichtiger und radikaler Bezugspunkt, da sie es versteht, in einem eigenwilligen Stil, eine hochliterarische Sprache mit den Rhythmen, den Ausdrucksweisen und den gedanklichen Grundstrukturen des Wolof, ihrer Muttersprache, dicht zu verweben. «Was Ihr auf französisch in meinen Romanen lest, ist die Art, wie man in meinem Dorf in unserer Sprache Wolof denkt und spricht.»
Die persönliche Geschichte der Autorin ist durch die historischen Ereignisse Afrikas geprägt. Sie kommt 1947 in einem isolierten Dorf in Senegal, das noch französische Kolonie ist, zur Welt. Ihr Vater ist bei ihrer Geburt 85 Jahre alt. Als Ken Bugul fünfjährig ist, verlässt die Mutter den Haushalt. Diese Erfahrung des Verlassenwerdens ist grundlegend. Sie fühlt sich nicht geliebt, ist aber voller trotziger Entschlossenheit und strebt nach Freiheit. Als erstes Mädchen ihrer Familie geht sie zur Schule und hat ausgezeichnete Noten. 1971 fliegt sie nach Europa, um weiter zu studieren. Wie sie in ihrem ersten Roman «Die Nacht des Baobab» schreibt: «Während zwanzig Jahren habe ich nur ihre Gedanken und ihre Gefühle gelernt. Ich hoffte, mich mit ihnen zu amüsieren, aber ich wurde enttäuscht: ich habe mich mit ihnen identifiziert, sie aber identifizierten sich nicht mit mir.» Silvia Voser führt uns mit Feingefühl in dieses geheimnisvolle und bewegte Leben. Sie lässt eine mutige und verletzliche Ken Bugul selber zu Wort kommen, und evoziert das Leben einer Künstlerin, deren Werk uns zu einem neuen Blick auf eine Welt voller komplexer Beziehungen verhilft.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
mit Bonus
Shanghai, Shimen Road
Haolun Shu
China
84′
Xiaoli ist 17, lebt in Shanghai und ist fasziniert von der Kamera, die er von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Diese ist in die USA ausgereist und hofft, dass ihr der Junge Fotos aus seinem Alltag schickt, bevor er nachreist. Er will bleiben, verliebt sich in die schöne Lanmi und erfährt von Lili, dass es in Beijing Studentendemos gegeben habe. Mit dem Blick auf das Leben einer Strasse betrachtet Haolun Shu feinfühlig den Wandel in Shanghai.
Shanghai ist die Boomtown Chinas mit einer langen und grossen Geschichte: Sie ist atemberaubend in mancherlei Hinsicht. Der junge Regisseur Haolun Shu nähert sich der Stadt und ihrer Entwicklung von innen heraus, indem er in seinem Spielfilm die Geschichte von Xiaoli erzählt, der in den späten 1980er Jahren an der Shimen Strasse in Shanghai aufwächst. Die Mutter lebt in den USA, und so sind sein Grossvater sowie die Nachbarin und beste Freundin Lanmi seine wichtigsten Bezugspersonen.
Lanmi arbeitet in einer Fabrik, träumt von einem besseren Leben im Ausland und gerät auf Abwege. Xiaoli beobachtet das still, ohne immer genau zu begreifen, was vor sich geht. Doch die erste Liebe entschwindet seinem unschuldigen Blick immer mehr. Mit der Klassenkameradin Lili, die frisch aus der Hauptstadt angekommen ist, entdeckt er das Leben ausserhalb seiner Strasse, die Studentenunruhen in Beijing und das sich wandelnde China, das sich westlichen Lebensformen öffnet. Er entwickelt erstmals so etwas wie ein politisches Bewusstsein. Shanghai, Shimen Road ist ein berührender Film über China, das riesige Reich mit den kleinen Gassen, ein Film über das Erwachsenwerden und die Träume junger Menschen, die hier noch mehr als anderswo mit Widersprüchen umgehen müssen. In China erscheinen sie besonders intensiv. Der Dokumentarfilmer Haolun Shu steht mit seinem Spielfilmerstling in der Bewegung des jungen chinesischen Kinos, das den Alltag sucht, er ist aber auch ein Filmemacher, der der schrillen Moderne nicht erliegt und in seiner kleinen Strasse bleibt, die immer noch typisch ist in der Grossstadt. Mit Augenmerk auf sie bringt er uns den Wandel nahe und hält fest, was schwindet.
Walter Ruggle
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.
Trans-Cutucu, Zurück in den Urwald (2009)
Lisa Faessler
Ecuador
92′
Das Bergmassiv Cutucú, im Süden des Amazonasgebietes in Ecuador, war ein Schutzwall gegen die ökologische Zerstörung, für die indianische Bevölkerung aber auch ein Hindernis. Sie hatten keinen Zugang zur modernen Welt. Der Strassenbau durch das Cutucú-Massiv eröffnet nun die Mobilität, welche den Abbau fossiler Ressourcen ermöglichen, aber den Ureinwohnern auch den gewünschten Anschluss an die zivilisierte Welt gewähren wird. Unspektakulär vollzieht sich dieser Prozess, wo der so genannte Fortschritt Einzug hält und nicht mehr zu bremsen ist: es wird gebaggert, geschaufelt, gerodet, verkauft und gekauft, der alltägliche Wahnsinn halt.Ausschnitte aus dem Film Shuar, Volk der heiligen Wasserfälle (1986) rufen uns in Erinnerung, dass in der traditionellen Shuarkultur, die Natur gesamthaft beseelt war und die Mobilität im halluzinogenen Rausch keine Grenzen kannte. Heute transportieren die Ureinwohner mit Pferden Holzbretter in die Zivilisation. Holz ist das schnellste Geschäft, andere Produkte müssen erst erzeugt werden. Doch nun verschwindet der Urwald, im alltäglichen Wahnsinn halt.
Zu Merkliste hinzugefügt
Von Merkliste entfernt
Die Anfrage ist fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und versuchen Sie es erneut. Falls dies nicht weiterhilft unterstützen wir Sie gerne per e-Mail unter support@filmingo.de oder telefonisch unter +41 (0)56 426 15 33
Um die Merkliste nutzen zu können, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch kein Konto bei uns haben.

Filmgenuss pur, rund um die Uhr: filmingo bietet eine kuratierte Auswahl an Arthouse-Filmen zum Streamen im Abonnement oder per Einzelmiete. Betrieben durch die Schweizer Stiftung trigon-film.


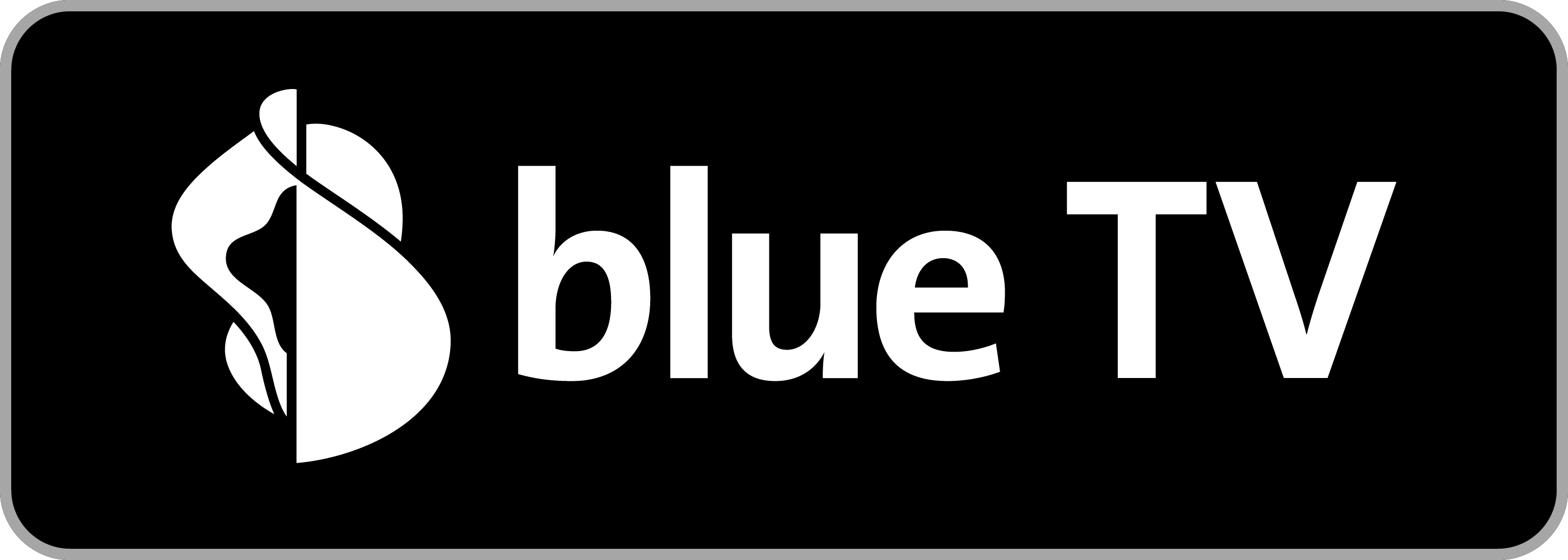
Support
+41 (0)56 426 15 33support@filmingo.de
Mo-Fr von 9:00 bis 17:00 Uhr

